Beim Besuch eines Klosters in Russland wurde ein Giftanschlag auf Horst Schwirkmann verübt. Als Elektronikfachmann des BND war er damit beauftragt, Abhöraktionen der Sowjets zu verhindern.
Von Florian Flade

„Ein langes und erfülltes Leben ging zu Ende“, so beginnt die Traueranzeige, die im Februar in einer Zeitung in Nordrhein-Westfalen erschien. Horst Schwirkmann wurde 93 Jahre alt. Und er hatte wohl nicht nur ein langes und erfülltes Leben, sondern ein ziemlich bewegtes noch dazu. Und das lag an seinem früheren Beruf.
Schwirkmann hat für den Bundesnachrichtendienst (BND) gearbeitet, er war ein Fachmann für Elektrotechnik, vor allem für Abhörgerätschaften. Dass seine Tätigkeit für den deutschen Auslandsnachrichtendienst bekannt ist, hat mit einem bis heute einmaligen Vorfall zu tun: Horst Schwirkmann wurde in den 1960er Jahren das Ziel eines Giftanschlags des sowjetischen KGB. Es ist der bislang einzige dokumentierte Fall eines BND-Mannes, der von einem gegnerischen Geheimdienst gezielt vergiftet wurde.
Im Herbst 1964 war Schwirkmann, damals 35 Jahre alt, an der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Moskau akkreditiert. Seine offizielle Position war die eines Dritten Sekretärs, einer der unteren diplomatischen Dienstgrade. Diplomatie aber war nicht Schwirkmanns eigentliche Aufgabe. In Wahrheit war er für den BND unterwegs. Man hatte ihn nach Moskau geschickt, um sicherzustellen, dass die Sowjets die diplomatische Vertretung der Bundesrepublik nicht verwanzen und abhören.
Das Bespitzeln der westlichen Botschaften war in der Sowjetunion eine allgegenwärtige Herausforderung. In zahlreichen Vertretungen europäischer Staaten, aber auch der USA, waren insbesondere in der Anfangszeit des Kalten Krieges immer wieder Abhörgerätschaften entdeckt worden. Darunter auch die wohl berühmteste sowjetische Wanze: „The Thing“.
Im August 1945, wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, bekam der US-amerikanische Botschafter In Moskau, Averell Harriman, von einer Gruppe sowjetischer Kinder als Geste der Freundschaft zwischen der Sowjetunion und den USA ein Geschenk überreicht: Eine Holzplatte, in die das Große Siegel, das nationale Symbol der USA eingraviert war. Botschafter Harriman zeigte sich dankbar und platzierte die Holzplatte in seinem Büro in der US-Botschaft in Moskau.
Sieben Jahre hing das vermeintliche Geschenk der Sowjets, das später nur „The Thing“ genannt wurde, dort. Bis Anfang der 1950er Jahre eher zufällig ein Techniker der britischen Botschaft beim Abhören sowjetischer Radiofrequenzen plötzlich Gespräche aus der amerikanischen Botschaft mithören konnte. Die weiteren Ermittlungen ergaben schließlich: In der Holztafel war eine Wanze versteckt, ein Gerät mit einer hochsensiblen Membran, das ohne eigene Stromquelle funktionierte, von außen angefunkt werden konnte und dann Geräusche übertrug.
Solche Spitzeleien der Sowjets zu unterbinden war die Aufgabe von Horst Schwirkmann. Am 01. April 1957 begann er seine Karriere beim BND, und zwar als Fachmann für Elektrotechnik und sichere Kommunikationssysteme. Er wurde schließlich als Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes getarnt nach Moskau versetzt, um die Technik der westdeutschen Botschaft im Auge zu behalten, nach möglicherweise unentdeckten Abhörgeräten zu suchen und Schutzvorrichtungen einbauen. Und das machte der BND-Mann offenbar ziemlich gut. Denn immerhin geriet er wohl schnell in den Fokus des KGB.
Weiterlesen

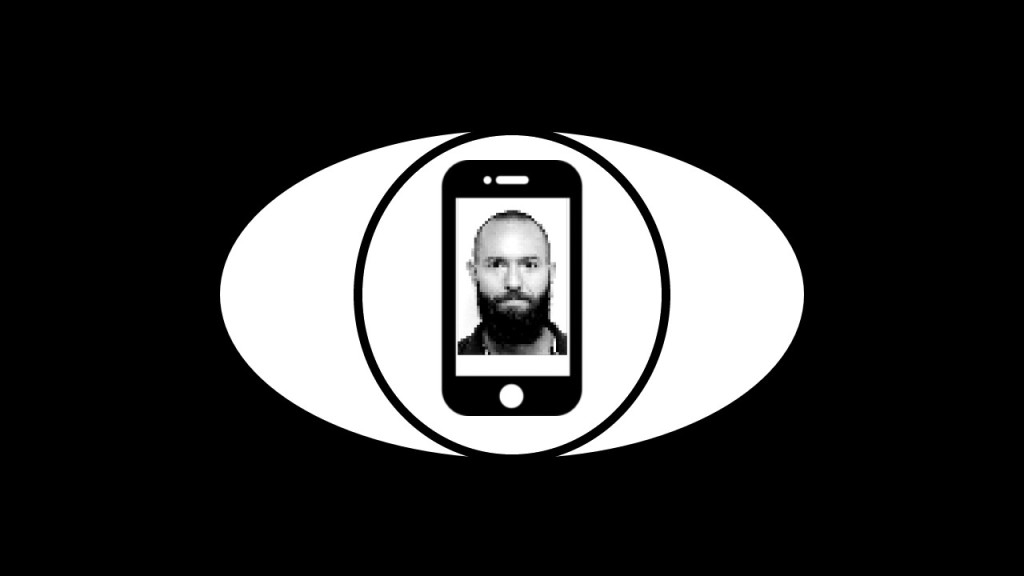
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.